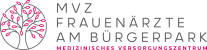26.11.2021
Mütter mit autistischem Kind können das Risiko verringern, dass das folgende Geschwisterchen ebenfalls Autismus entwickelt. Indem sie bis zur nächsten Schwangerschaft zweieinhalb bis drei Jahre warten.



Bisherige Studien deuten darauf hin, dass sehr kurze oder lange Schwangerschaftspausen das Risiko für Autismus-Spektrum-Störungen beim nächsten Kind erhöhen können. Ein internationales Forscherteam untersuchte nun in einer groß angelegten internationalen Studie, inwieweit das Schwangerschafts-Intervall das Autismus-Risiko beeinflusst.
Etwa jedes 100. Kind entwickelt eine Autismus-Spektrum-Störung
Unter Leitung von Dr. Gavin Peraira, Professor an der Curtin Universität, analysierte das Team Gesundheitsdaten von 925.523 Kindern, die zwischen 1998 und 2007 in Schweden, Finnland und Dänemark geboren wurden. Darunter fanden sich 9.302 Kinder, bei denen eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wurde. Als Quelle dienten die Gesundheitsregister der jeweiligen Länder.
Geringstes Autismus-Risiko bei 30 bis 39 Monaten Schwangerschaftspause
Bei einer Schwangerschaftspause von 30–39 Monaten lag das Autismus-Risiko für das Kind am niedrigsten. Das relative Autismus-Risiko erhöhte sich um 50 %, wenn eine Frau nur drei Monate abwartete. Nach 5 Jahren Schwangerschaftspause nahm das relative Autismus-Risiko um 24 % zu. Die Forschenden schätzen, dass 5–9 % aller Autismus-Fälle durch optimierte Schwangerschafts-Intervalle vermeidbar wären.
Ergebnisse wichtig bei familiär erhöhtem Autismus-Risiko
Bisher galten nur genetische und biologische Faktoren als relevant für die Entwicklung von Autismus-Spektrum-Störungen. Die Ko-Autorin Dr. Helen Leonard, Professorin am Telethon Kids Institut, sieht die Ergebnisse besonders wichtig für Familien an, bei denen ein erhöhtes Autismus-Risiko vorliegt. Beispielsweise bei Frauen, die bereits ein autistisches Kind haben.
Quelle: Gavin Pereira et al, Optimal interpregnancy interval in autism spectrum disorder: A multi‐national study of a modifiable risk factor, Autism Research (2021). DOI: 10.1002/aur.2599